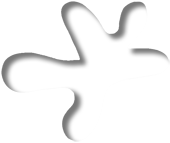A
Bei ADHS und ADS handelt es sich um Aufmerksamkeitsdefizitstörungen. Das „H“ in ADHS bedeutet, dass hier auch die Hyperaktivität eine Rolle spielt.
Menschen, die von einer Aufmerksamkeitsstörung betroffen sind, lassen sich leicht ablenken oder sind verträumt (Unaufmerksamkeit), zappeln viel herum und sind unruhig (Hyperaktivität) oder reagieren sehr voreilig (Impulsivität).
Allerdings treten nicht alle drei Merkmale bei jedem gemeinsam auf. Auch können die Merkmale unterschiedlich stark ausgeprägt sein.
ADS und ADHS kommen relativ häufig vor, etwa 5 von 100 Kindern sind betroffen.
Wie ADHS/ADS entsteht ist noch nicht vollständig geklärt, vermutlich spielen mehrere Aspekte (unter anderem genetische Faktoren (→ siehe Bio-Psycho-Soziales-Modell) eine Rolle.
Bei der Behandlung von ADHS/ADS wird meist mit dem Umfeld des Kindes zusammengearbeitet, das heißt die Eltern oder Lehrer/innen werden in die Therapie mit einbezogen. Manchmal können auch Medikamente helfen.
Wut ist ein normales und wichtiges Gefühl, da es zum Beispiel einen Hinweis auf erfahrene Ungerechtigkeit geben kann. Wenn allerdings Wut und aggressives Verhalten bei Kindern und Jugendlichen überhandnimmt, spricht man von einer Störung.
Es können dabei folgende Formen unterschieden werden: oppositionelles Verhalten, aggressives Verhalten und dissoziales Verhalten.
Unter einer oppositionellen Verhaltensstörung versteht man das generelle Verweigern von Anweisungen. Die Kinder oder Jugendlichen reagieren schnell wütend oder boshaft, sind zudem leicht beleidigt und nachtragend. Sie ärgern Andere und können ihr eigenes Fehlverhalten oft nicht ausreichend erkennen.
Menschen, die unter einer aggressiven Verhaltensstörung leiden, zeigen Verhalten, dass die Rechte anderer verletzt. Sie brechen die Regeln von Autoritätspersonen und bedrohen, schlagen oder quälen Andere oder zwingen diese zu sexuellen Handlungen.
Dissoziales Verhalten tritt meist im Jugendalter auf. Es umfasst das Zerstören von Eigentum anderer, Betrug, Diebstahl, Lügen, Weglaufen von zu Hause und Schule schwänzen.
Viele der genannten Verhaltensweisen werden ab und zu von allen Kindern gezeigt, aber wenn dieses Verhalten über längere Zeit in verschiedenen Lebensbereichen auftritt, Entwicklungsschritte der Kinder behindert oder andere stark einschränkt, spricht man von einem Verhalten mit Krankheitswert.
Oppositionelles Verhalten kommt bei etwa 3% der Kinder vor und eine Störung des Sozialverhaltens (dissoziales Verhalten) bei ca. 2%.
Die Ursachen für solch ein Verhalten sind vielfältig.
Biologische Faktoren (z.B. erhöhte neurologische Erregbarkeit, niedrige Kortisolwerte, niedriges Aktivitätsniveau, reduzierte Serotoninaktivität, Belastungen in der Schwangerschaft oder Geburtskomplikationen) spielen ebenso eine Rolle wie psychische Faktoren (z.B. ein schwieriges Temperament, unzureichende Impulskontrolle, überhöhte Selbsteinschätzung, unzureichendes Einfühlungsvermögen) und soziale Faktoren (z.B. unsichere Bindung, mangelnde elterliche Aufsicht, negative Erziehungspraktiken, unzureichende emotionale Unterstützung, Ehekonflikte, familiäre Stressbelastung, körperliche Misshandlung, soziale Ablehnung durch Gleichaltrige).
Für die Diagnose und Behandlung ist wichtig, ob das aggressive Verhalten den Kern der Störung ausmacht oder ob sie begleitender Ausdruck einer anderen psychischen Erkrankung z.B. einer Depression oder Angststörung ist. Zudem tritt Aggressivität auch in Verbindung mit ADHS oder Substanzmissbrauch auf.
Dadurch, dass eine aggressive Verhaltensstörung nicht nur für das Umfeld, sondern auch für die betroffenen Kinder und Jugendlichen sehr belastend ist, ist eine genaue Diagnostik und Therapie sinnvoll. In dieser werden besonders auch die Eltern und manchmal Lehrer_innen mit einbezogen.
Die Kinder lernen, wie sie ihr Verhalten besser steuern können und wie sie langfristig gute Beziehungen knüpfen können. Dabei brauchen sie viel Lob, aber auch klare Regeln und Grenzen durch die Eltern. Gemeinsam mit der Therapeutin kann ein Trainingsprogramm für die ganze Familie erarbeitet werden. Manchmal werden auch zusätzlich Medikamente eingesetzt.
Eigentlich ist Angst ein normales und wichtiges Gefühl, das vor Gefahren warnen und schützen kann. Menschen mit einer Angststörung reagieren jedoch sehr viel ängstlicher als es zur Sicherheit unbedingt notwendig wäre.
Die Angststörung geht oft einher mit körperlichen Symptome wie Herzklopfen, Schwitzen, Bauchschmerzen.
Auf der Verhaltensebene reagieren Menschen mit einer Angststörung mit Vermeidung. Vermeidungsverhalten bedeutet, dass die betroffenen Menschen Situationen meiden, in denen sie dem Gegenstand der Angst begegnen könnten. Wenn eine Situation nicht vermieden werden kann, wird diese von Menschen mit einer Angststörung unter hohem inneren Druck durchgestanden. Dies ist von außen häufig nicht sichtbar.
Angststörungen oder phobische Störungen sind sehr vielfältig und können sich auf verschiedene Teilbereiche des Lebens beziehen. So gibt es z.B. Soziale Phobien, Leistungsängste, Trennungsängste, Schulangst, Panikstörungen, Generalisierte Angststörungen oder verschiedene Spezifische Phobien, wie Ängste vor bestimmten Tieren.
Solche starken Ängste kommen relativ häufig vor, etwa 5-15%, der Bevölkerung sind betroffen. Das heißt, dass zum Beispiel in einer Schulklasse 1 bis 3 Kinder Angststörungen haben können. Die Ursachen für Angststörungen sind vielfältig: die Gene spielen eine Rolle, aber z.B. auch erlerntes Verhalten.
Bei der Anorexie | Anorexia nervosa oder auch Magersucht, handelt es sich um eine Essstörung, bei der die Betroffenen deutlich weniger als nötig essen und meist panische Angst vor einer Gewichtszunahme haben.
Ein wichtiges Kriterium ist ein Körpergewicht, das mindestens 15% unter dem für das Alter erwarteten, typischen Gewicht liegt. Weitere wichtige Kennzeichen sind ein pathologisches (krankhaftes) Essverhalten, Körperbildstörungen (die Betroffenen nehmen nicht wahr, wie dünn sie sind und glauben häufig, dass sie eigentlich übergewichtig seien), ein geringer Selbstwert, psychosoziale und sexuelle Probleme, Depressionen und Perfektionismus.
Etwa 0,3-1% der Bevölkerung sind einmal im Leben von Anorexie betroffen. Die Störung tritt meist erstmals im Jugendalter auf. Vor allem Mädchen erkranken an Magersucht, wobei die Zahl der Jungen zunimmt.
Verschiedene Faktoren können zur Entwicklung einer Anorexie beitragen. So spielen zum Beispiel soziokulturelle Faktoren, wie Schönheitsideale der Gesellschaft, aber auch genetische Faktoren, individuelle Faktoren oder familiäre Merkmale eine wichtige Rolle.
Magersucht ist eine sehr ernst zu nehmende und gefährliche Erkrankung, die schwerwiegende körperliche und seelische Folgen haben kann. Durch die Mangelernährung kann es zu nachhaltigen körperlichen Störungen im Mineralstoffhaushalt, Ausbleiben der Regelblutung, Durchblutungsstörungen, Veränderungen des Nervensystems und Problemen bei der Temperaturregulation kommen.
Daher ist es wichtig, zügig Hilfe zu suchen, da Anorexie zu den psychischen Krankheiten mit der höchsten Sterblichkeitsrate gehört. Oftmals ist bei Anorexie eine stationäre Behandlung sinnvoll, unter bestimmten Bedingungen ist aber auch eine ambulante Therapie möglich.
Gemeinsam mit der Verhaltenstherapeutin und oft auch unter Einbezug der Familie, wird versucht, die betroffenen Menschen zu einem gesunden Körpergewicht und zu einem gesunden Essverhalten zu führen sowie die psychischen Begleiterscheinungen zu bearbeiten.
B
Beim Binge-Eating kommt es zu unkontrollierbaren Essanfällen ohne Kompensation z.B. durch Erbrechen. Stattdessen wird versucht, nach einem Essanfall das Essverhalten stark zu kontrollieren. Da dies oft nicht wie gewünscht gelingt, sondern eher zu erneuten Essanfällen führt, leiden die Betroffenen häufig an Übergewicht. Die Zeitdauer der Essanfälle ist, anders als bei der Bulimie, nicht klar abgrenzbar und kann sich über einen längeren Zeitraum erstrecken. Die betroffenen Menschen haben häufig ein negatives Körperbild. Die Essanfälle werden oft durch Konflikte oder Stimmungsschwankungen ausgelöst und zum Spannungsabbau verwendet. Die Betroffenen leiden meist sehr unter dem erlebten Kontrollverlust. Von einer Binge-Eating-Disorder sind etwa 2,6% der Allgemeinbevölkerung betroffen. Die Folgen umfassen vor allem Übergewicht, aber auch Depressionen oder soziale Phobien können sich entwickeln und damit die Lebensqualität stark einschränken. In der Therapie wird versucht, die Auslöser für die Essanfälle zu identifizieren und ein regelmäßiges Essverhalten zu etablieren, so dass langfristig zu einem normalen Essverhalten zurückgefunden werden kann.
Die physische und psychische Gesundheit eines jeden Menschen hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Nicht nur biologischen Bedingungen (z.B. genetische Veranlagung, körperliche Erkrankungen) spielen eine Rolle, sondern auch soziale Faktoren (z.B. sozioökonomischer Status, soziales Netzwerk, ethnische und religiöse Zugehörigkeit) und psychische Aspekte (z.B. Einstellungen, Umgang mit Emotionen). Das bio-psycho-soziale Modell beschreibt psychische Erkrankungen als ein Zusammenspiel der drei Gebiete, die sich insgesamt auf den Gesundheitszustand und das Verhalten eines Menschen auswirken. Darin sind also die angelegten Schutz- und Risikofaktoren genauso wichtig, wie das, was ein Mensch im Laufe seines Lebens und im Umgang mit anderen im nahen sozialen Bereich wie z.B. Familie und im erweiterten Umfeld wie Kindergarten, Schule oder Beruf und Freundschaftsbeziehungen, erlernt und daraus macht.
Die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist nicht einfach zu beschreiben und nicht einfach gegen andere psychische Erkrankungen abzugrenzen. Zur Feststellung einer Borderline-Störung ist eine intensive professionelle Diagnostik besonders wichtig. Bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung sind verschiedene Bereiche des Erlebens und Verhaltens betroffen. Diese zeigen sich in vier Hauptbereichen: Affektivität, Impulsivität, Kognition und interpersonale Beziehungen. Die Gefühlsregulation (Affektivität) ist verändert. Die Betroffenen zeigen oft übermäßige Wut, haben Schwierigkeiten, ihren Ärger zu kontrollieren oder leiden sehr unter besonders intensiven Stimmungsschwankungen. Auch die Neigung zum voreiligen Handeln (Impulsivität) ist erhöht, was sich beispielsweise häufig in selbstschädigendem Verhalten (z.B. Ritzen), risikoreichem Verhalten (z.B. Substanzmissbrauch) und wiederholten Suiziddrohungen oder Suizidversuchen zeigen kann. Die Wahrnehmung und Verarbeitung von Eindrücken (Kognition) kann betroffen sein. Das heißt, Menschen mit Borderline haben teils stressabhängige paranoide Vorstellungen, dissoziative Symptome oder Identitätsstörungen. Außerdem kommt es zu Störungen im interpersonalen Bereich. Menschen mit Borderline haben oft gleichzeitig sowohl Angst vor dem Alleinsein als auch Angst vor Nähe und führen dadurch viele intensive und instabile Beziehungen. Zu den Ursachen einer Borderline-Störung zählen unter anderem genetische Faktoren und psychosoziale Belastungsfaktoren. Durch die Schwierigkeiten, die in verschiedenen Lebensbereichen auftreten, sind die betroffenen Menschen oft sehr belastet und verzweifelt. In der Therapie kann jedoch erlernt werden, wie es möglich ist, mit der Erkrankung ein geregeltes Leben zu führen. Etwa 1 bis 4% der Bevölkerung erkranken an einer Borderline-Störung. Da die Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen der pubertären Umstrukturierung noch nicht abgeschlossen ist, wird die Diagnose selten vor dem 18. Lebensjahr gegeben.
Unter Bulimie | Bulimia nervosa oder auch Ess-Brech-Sucht, versteht man eine Störung des Essverhaltens, bei der, von den Betroffenen als unkontrollierbar erlebte, Essanfälle auftreten. Die durch die Essanfälle stark erhöhte Kalorienzufuhr wird dann meist durch willentlich herbeigeführtes Erbrechen oder die Einnahme von Abführmitteln ausgeglichen. Die Kennzeichen bei einer Bulimie sind denen der Anorexie sehr ähnlich: auch hier kommt es zu pathologischem (krankhaftem) Essverhalten, teilweise Körperbildstörungen (die betroffenen Menschen halten sich für übergewichtig, obwohl sie meist normalgewichtig sind), geringer Selbstwert, psychosoziale und sexuelle Probleme und Depressionen. Bulimie tritt etwa bei einem bis vier von hundert Menschen einmal im Leben auf, meistens entsteht sie jedoch im Jugendalter. Auch hier spielen verschiedene Faktoren bei der Entstehung eine Rolle, so sind familiäre Faktoren, biologische Faktoren und individuelle Faktoren wichtig. Bei einer Bulimie kann es aufgrund der Mangelernährung (dadurch, dass viele Nährstoffe wieder erbrochen oder abgeführt werden) zu körperlichen Problemen kommen. Die Zähne werden durch das Erbrechen stark beschädigt, Müdigkeit, trockene Haut, Haarausfall, aber auch Nierenschädigungen oder Bauchspeicheldrüsenentzündungen können entstehen. In der Verhaltenstherapie wird gemeinsam mit der Therapeutin versucht, ein geregeltes und gesundes Essverhalten aufzubauen und die psychischen Begleiterscheinungen zu bearbeiten.
Unter Bullying versteht man negative soziale Handlungen unter Kindern und Jugendlichen. Im deutschen Sprachraum wird häufig auch das Wort „Mobbing“ verwendet, was sich aber eigentlich nur auf den Arbeitsplatz und damit auf Erwachsene bezieht.
Bullying ist ein relativ häufiges Phänomen (ca. 8% der Kinder in Deutschland leiden einmal pro Woche unter auftretenden Bullying-Attacken) und spielt sich meist in der Schule ab. Es handelt sich dabei um gezieltes Zufügen von Schaden. Bullying kann unterschiedliche Formen annehmen. Es kann direkt ablaufen z.B. durch körperliche Gewalt, Erpressen, offenes Beschädigen von Eigentum oder auch indirekt z.B. durch Ausgrenzung, Verleumdung, Diebstahl.
Eine Sonderform ist das Cyber-Bullying. Dabei finden die Angriffe auf das Opfer z.B. durch Beleidigen, Lästern, Erpressen im Internet statt. Bei Cyber-Bullying ist es oft schwierig, die Täter_innen zu ermitteln und das Opfer hat wenig Möglichkeiten, den Angriffen zu entfliehen. Für die Definition von Bullying ist wichtig, dass erst mehrere schädliche Handlungen als Bullying gezählt werden. Teilweise können jedoch auch schon einzelne Handlungen sehr traumatisierend für das Opfer sein.
Theoretisch kann jedes Kind ein Opfer von Bullying werden. Es gibt jedoch spezielle psychische Risikofaktoren wie z.B. ADHS, sozial-unsichere Störungen, depressive Störungen, Störungen aus dem autistischen Spektrum, phobische Störungen, die dazu führen können, dass ein Kind eher zum Opfer wird.
Auch dafür, dass Kinder zu Bullying-Täter_innen werden, gibt es Risikofaktoren wie z.B. aggressive Verhaltensweisen, Gewalt im Elternhaus, zu strenge oder zu lasche Erziehung.
Bullying ist ein ernst zu nehmendes Thema, da es, wenn der Prozess nicht gestoppt wird, immer zu psychischen Schäden beim Opfer und häufig auch bei den Täter_innen führen kann.
Psychische Folgestörungen bei Opfern umfassen z.B. Ängstlichkeit, Konzentrationsprobleme, Schmerzen, Essstörungen, Schlafstörungen, Substanzmissbrauch, Depressionen oder Suizid. Bei den Täter_innen kann es z.B. zu Depressionen, Suchtstörungen, Ängstlichkeit, einer dissozialen Persönlichkeitsstörung oder Suizid kommen.
Daher sollten Eltern und Lehrer_innen die Sorgen der Kinder unbedingt ernst nehmen und bei Vorliegen von Bullying gemeinsam eingreifen.
D
Ein wenig traurig oder niedergeschlagen sind alle Menschen ab und an. Depressionen sind aber eine Ernst zunehmende Krankheit, die sich davon deutlich unterscheidet. Von Depressionen betroffene Menschen leiden an ausgeprägter Traurigkeit und Niedergeschlagenheit (depressive Verstimmung). Oft ist auch ihre Fähigkeit Freude an etwas zu finden reduziert und sie verlieren Interesse an etwas, das früher spannend war (Anhedonie). Außerdem haben Depressive oft einen verminderten Antrieb (Ermüdbarkeit). Diese Merkmale treten über einen längeren Zeitraum auf. Zusätzlich haben depressive Menschen oft auch Appetitverlust, Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, Schuldgefühle, ein geringeres Selbstwertgefühl oder Suizidgedanken. Bei Kindern sind Depressionen teils schwieriger zu erkennen und zeichnen sich manchmal noch durch andere Symptome wie Reizbarkeit, körperliche Beschwerden, Trennungsängste oder Rückzug von sozialen Beziehungen aus. So haben die Kinder zum Beispiel keinen Spaß mehr daran, ihre Freunde zu treffen und andere Dinge zu tun, die ihnen früher Spaß gemacht haben oder sie fühlen sich in der Schule unter- oder überfordert. Auch sind sie mit ihren eigenen Leistungen unzufrieden oder reagieren schnell weinerlich oder aggressiv. Depressionen sind die häufigste psychische Krankheit, etwa jeder fünfte ist mindestens einmal im Leben von ihnen betroffen. Verschiedene Faktoren können zur Entstehung einer Depression beitragen, zu ihnen zählen genetische Aspekte, Stoffwechselstörungen, belastende Lebensereignisse oder Stress.
E
Enkopresis oder Einkoten ist das willentliche oder unwillentliche Absetzen von Stuhl ab einem Alter von vier Jahren. Die Störung kommt relativ häufig vor, etwa 1 bis 3% der Schulkinder koten ein. Die Ursachen sind vielfältig. Die Genetik ist sehr wichtig, aber auch belastende Faktoren wie ein Umzug oder die Geburt eines Geschwisters können Auslöser sein. Häufig leiden die Betroffenen auch gleichzeitig unter einer Enuresis. Weitere gleichzeitig vorkommende Störungen können z.B. sein: emotionale Störung mit Trennungsangst, soziale Phobien, generalisierte Angststörungen, depressive Störungen, ADHS oder oppositionelles Verhalten. Bei der Behandlung müssen zunächst immer organische Ursachen ausgeschlossen werden. Danach umfasst die Therapie Psychoedukation und vor allem ein Toilettentraining. Kommt es in Verbindung mit dem Einkoten zu einer Verstopfung, haben die Betroffenen oft Schmerzen, so dass mit ärztlicher Begleitung Abführmittel eingesetzt werden.
Unter Enuresis oder Einnässen versteht man nicht gewollten Harnabgang ab einem Alter von 5 Jahren, nachdem organische Ursachen ausgeschlossen wurden. Es gehört zu den häufigsten Störungen des Kindes- und Jugendalters. Etwa 10% der Kinder im Einschulungsalter sind von Enuresis betroffen, diese Zahl reduziert sich mit zunehmendem Alter. Es sind manchmal auch Jugendliche oder Erwachsene von Enuresis betroffen.
Unterschieden wird zwischen Enuresis nocturna (nächtliches Einnässen) und funktioneller Harninkontinenz (Einnässen tagsüber). Meist geschieht das Einnässen nicht willkürlich und ist mit einem Leidensdruck der betroffenen Kinder und auch Eltern verbunden. Die Ursachen für das Einnässen sind vor allem genetisch bedingt. Die Enuresis kann auch gleichzeitig mit der Enkopresis (Einkoten) vorkommen. Manchmal kommt es beim Einnässen zu einer spontanen Rückbildung.
Ansonsten kann man die Störung gut mit einer Verhaltenstherapie behandeln. Kind gerecht wird darüber informiert, wie der Körper arbeitet und wie es möglich ist, den Körper besser wahrzunehmen und günstig zu beeinflussen. Gemeinsam mit den Eltern wird ein spezieller Trainingsplan (Trinken, Toillettengang) erstellt. Teilweise kommen auch Hilfsmittel wie z.B. Klingelhosen oder Klingelmatten zum Einsatz. Manchmal können auch Biofeedback oder Medikamente helfen.
Unter Essstörungen werden verschiedene Erkrankungen zusammengefasst, die sich auf verändertes Essverhalten beziehen. Man unterscheidet die Anorexie | Anorexia nervosa | Magersucht, die Bulimie | Bulimia nervosa und das Binge Eating. Im Säuglings- und Kleinkindalter können als frühkindliche Regulationsstörung Fütterstörungen auftreten. Außerdem kommen auch partielle Essstörungen vor, diese erfüllen nicht alle Kriterien einer der oben genannten Störungen, sind jedoch recht häufig (10-15%) und können dennoch behandlungsbedürftig sein.
F
Unter Fütterstörungen versteht man Störungen des Essverhaltens in der frühen Kindheit. Sie werden auch zu den Regulationsstörungen gezählt. Etwa 20% der Kinder haben Fütter- oder Essprobleme, schwere Störungen sind hingegen selten. Die Ursachen sind vielfältig und es wird zwischen kindbezogenen und elternbezogenen Ursachen unterschieden. Zu den kindbezogenen Ursachen zählen angeborene Eigenschaften, wie das Temperament, aber auch Interesse an der Nahrung, Essensvorlieben, kindliche Depressionen oder krankheitsbedingte Einschränkungen. Die elternbezogenen Faktoren umfassen elterliche Depressionen, Ängste, Konflikte oder auch eigene Essprobleme der Eltern. Fütterprobleme können jedoch auch durch fehlerhafte Interaktion zwischen Eltern und Kind zustande kommen und spielen bei der Autonomieentwicklung des Kindes eine Rolle. Die Folgen einer Fütterstörung sind Gewichts- und Wachstumsprobleme beim Kind und oft große Belastungen der ganzen Familie. Durch relativ einfache Maßnahmen, wie die Einführung von festen Mahlzeiten oder das Schaffen einer entspannten und ablenkungsfreien Atmosphäre beim Essen, können Fütterstörungen oft gut behandelt werden.
G
Eine generalisierte Angststörung ist eine Störung, bei der Menschen sich sehr viele und starke Sorgen machen, die mehrere Lebensbereiche betreffen. Symptome dabei können Vermeidungsverhalten, Anspannung, Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafstörungen, Unruhe und geringes Selbstvertrauen sein oder auch der Wunsch nach Rückversicherung, dass die Sorgen unbegründet sind - z.B. durch die Eltern. Die davon betroffenen Menschen befürchten, viele Situationen nicht meistern zu können und dass das Schlimmste eintreten könnte.
M
siehe Bullying
Unter elektivem oder auch selektivem Mutismus versteht man das Unvermögen, in bestimmten Situationen oder mit bestimmten Personen zu sprechen. Die eigentliche Fähigkeit zu sprechen ist jedoch vorhanden und die Betroffenen reden auch ohne Probleme z.B. mit der Familie. Häufig tritt der Mutismus im Vorschul- oder Einschulungsalter auf. Die Ursachen für elektiven | selektiven Mutismus sind vielfältig. Die Vererbung ebenso wie die Persönlichkeit des Kindes, ungünstige Erziehung, situationsspezifische Faktoren, eine Trotzphase oder traumatische Erlebnisse können eine Rolle spielen.
Mutismus kann gleichzeitig mit anderen psychischen Störungen wie Angststörungen, Entwicklungsstörungen, Schlafstörungen, Depressionen, Hyperaktivität, Zwängen oder Trennungsangst auftreten. Die Häufigkeit von elektivem | selektivem Mutismus wird mit 0,1 – 0,7%, also ca. 1 Kind von 200, angegeben. Nachdem organische Ursachen ausgeschlossen wurden, kann eine multidimensionale Therapie begonnen werden. In der Verhaltenstherapie wird z.B. mit einer Funktionsanalyse versucht, herauszufinden, in welchen Situationen es für das Kind Sinn macht, nicht zu sprechen. Durch Veränderungen von Rahmenbedingungen und alternativen nonverbalen Kommunikationsangeboten wird zusammen mit dem Kind versucht, den Weg zum Sprechen zu ebnen. Die Eltern werden mit einbezogen, damit sie ihrem Kind optimal helfen können.
O
siehe Aggression
P
Unter Panikstörungen versteht man zeitlich begrenzte Anfälle von akuter Angst (auch: Panikattacken, Panikanfälle oder Angstanfälle). Dabei treten die unangenehmen Symptome plötzlich und spontan auf, das heißt die betroffene Person kann sich diese nicht erklären.
Symptome sind zum Beispiel: Herzklopfen, Übelkeit, Zittern, Atemnot oder Schwitzen.
Während eines Panikanfalls zeigen die Menschen oft hilfesuchendes Verhalten. Häufig wird das alltägliche Leben an die Panikanfälle angepasst, so dass viele Dinge, die diese auslösen könnten, vermieden werden.
Unter einem psychischen Trauma versteht man eine psychische Störung, die nach besonders belastenden Ereignissen eintritt.
Bei den meisten Menschen kommt es nach dem Erleben von extrem belastenden Ereignissen kurzzeitig zu traumatischen Symptomen, man spricht dann von einer akuten Belastungsstörung. Oft legen sich die Symptome jedoch wieder.
Wenn die Symptome aber nicht weggehen, sondern sich chronifizieren spricht man von einer Posttraumatischen Belastungsstörung. Diese kann auch erst Monate nach dem belastenden Ereignis auftreten.
Die Auslöser für eine Posttraumatische Belastungsstörung sind unterschiedlich. Dabei kann es sich z.B. um Naturkatastrophen, Unfälle, Kriegserlebnisse, erlebte sexuelle oder andere Gewalt, Suizidversuche oder Kindesvernachlässigung handeln. Die Betroffenen wurden also mit einem Ereignis außergewöhnlichen Ausmaßes konfrontiert, das bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde.
Bei Personen, die eine Posttraumatische Belastungsstörung haben, zeigen sich vielfältige Symptome.
Zum Beispiel kommt es zum Wiedererleben des traumatischen Erlebnisses, etwa durch ständiges Erinnern. Bei Kindern zeigt sich dies häufig indem immer wieder Aspekte des Traumas in ihren Spielen auftauchen.
Außerdem kann es zu belastenden Träumen kommen. Bei Kindern kann es auch zu Alpträumen ohne erkennbaren Inhalt kommen.
Viele von einer Posttraumatischen Belastungsstörung betroffene Menschen zeigen auch Vermeidungsreaktionen, indem sie allen Reizen, Orten und Aspekten, die mit dem Trauma in Verbindung stehen, aus dem Weg gehen. Diese Vermeidungsreaktionen sind bei Kindern schwerer erkennbar. Betroffene Kinder können das Gefühl einer eingeschränkten Zukunft zeigen (sie glauben gar nicht mehr daran, erwachsen zu werden).
Dazu kommt, dass die Betroffenen auch Symptome erhöhter Erregbarkeit, wie Konzentrationsschwierigkeiten oder übertriebene Schreckreaktionen oder Lernschwierigkeiten, Wutausbrüche oder Schlafstörungen zeigen können.
Bei Kindern kann es vorkommen, dass sie bereits erlernte Fähigkeiten wieder verlernen oder aggressives Verhalten oder Trennungsängste entwickeln.
Oft treten neben einer Posttraumatischen Belastungsstörung auch Substanzmissbrauch oder andere psychische Störungen wie Depressionen auf. In Krisenregionen oder Regionen mit vielen Naturkatastrophen kommen Posttraumatische Belastungsstörungen häufiger vor.
Nicht jeder Mensch entwickelt nach einem traumatischen Ereignis eine Posttraumatische Belastungsstörung. Dabei spielen auch genetische Veranlagungen, psychische Schutzfaktoren und die Art des traumatischen Ereignisses eine Rolle. In Deutschland entwickeln etwa 1,3 bis 1,6% der Menschen einmal im Leben eine Posttraumatische Belastungsstörung.
Trotz der Schwere der Störung gibt es gute psychotherapeutische Programme in denen die betroffenen Menschen lernen, mit ihrer Traumatisierung zu leben und ihre Symptome zu mildern. In der psychotherapeutischen Arbeit mit Kindern ist die Elternarbeit sehr wichtig, da deren eigene Belastung mit dem Thema ebenfalls eine Rolle spielt.
S
Schmerz ist ein wichtiges Signal des Körpers. Akute Schmerzen können vor einer organischen Schädigung warnen und zeigen, dass etwas im Körper nicht stimmt. Dauernde oder langanhaltende Schmerzen, wie chronische Schmerzen, haben diese Schutzfunktion allerdings meist verloren. Sie können eine zweite Funktion übernommen haben und ein Zeichen für etwas anderes wie z.B. Stress, Überlastung oder Ängste sein.
Eine Schwierigkeit bei der Diagnose und Behandlung von Schmerzstörungen ist, dass Schmerz ein subjektives Gefühl ist, das nicht nur sensorische, sondern auch emotionale Qualitäten hat und man Schmerz nicht sehen kann. Schmerz spielt sich nicht nur auf biologischer Ebene ab (Nervensystem) sondern umfasst auch familiäre, kulturelle und soziale Faktoren sowie Gefühle und Erfahrungen. Außerdem ist für das Schmerzempfinden der Umgang mit den Schmerzen relevant, z.B. wie viel und welche Aufmerksamkeit man dem Schmerz zukommen lässt. Auch die Angst vor den Schmerzen, die schlimmer sein kann als die Schmerzen selbst, spielt eine große Rolle.
Wie Schmerzstörungen entstehen ist nicht vollständig geklärt. Oft haben sie einen Auslöser, wie z.B. einen Unfall, eine Wunde oder eine Erkrankung. Obwohl die organischen Schäden eigentlich schon verheilt sind, können die zugehörigen Schmerzen bleiben. Es kann bei einer Schmerzstörung auch vorkommen, dass es keinen körperlichen Auslöser gab, jedoch trotzdem Schmerzen empfunden werden. Manchmal befürchten die Betroffenen, an einer schlimmen Krankheit zu leiden, weil sie sich die Schmerzen nicht erklären können. Zu den Schmerzerkrankungen bei Kindern zählen z.B. Migräne, Spannungskopfschmerzen oder Bauchschmerzen. Es können auch Schwindelgefühle oder Übelkeit hinzukommen. In die Behandlung sollte die ganze Familie mit einbezogen werden, da der Umgang der Eltern mit den Schmerzen des Kindes sehr relevant für die Ausprägung der Schmerzstörung sein kann.
In der Therapie wird unter anderem mit Psychoedukation zu Schmerz auslösenden und Schmerz hemmenden Körperprozessen, Entspannung, Biofeedback und multimodalem Training gearbeitet. Manche chronischen Schmerzen werden den Betroffenen ein Leben lang begleiten, so dass es in der Therapie bspw. darum gehen kann, einen erträglichen Umgang mit dem Schmerz zu finden.
Menschen mit sozialer Phobie haben eine ausgeprägte und anhaltende Angst vor sozialen Situationen oder Leistungssituationen.
Oft vermeiden sie es, mit fremden Menschen zu sprechen oder sich in soziale Situationen zu begeben, in denen Peinlichkeiten auftreten könnten. Dadurch verpassen sie viele Dinge und Interaktionen, die eigentlich Spaß machen und fühlen sich häufig unglücklich.
Auch kann es sein, dass sich bestimmte Situationen nicht vermeiden lassen und von Menschen mit sozialer Phobie nur unter großer Angst und Anstrengung ertragen werden.
Bei den spezifischen Phobien handelt es sich um eine starke Angst vor einem gefürchteten Objekt oder einer Situation. Dabei kann es sich zum Beispiel um Tiere, Höhen, Spritzen oder kleine Räume handeln. Im Unterschied zu normalen Ängsten sind spezifische Phobien übermäßig stark, anhaltend, treten spontan auf und führen dazu, dass die Situation gemieden wird (Vermeidungsverhalten). Dies kann zu großen Einschränkungen im alltäglichen Leben führen.
T
siehe Posttraumatische Belastungsstörung
Bei der Angststörung mit Trennungsangst haben Menschen übermäßige Angst, ihre Bezugspersonen zu verlieren oder von ihnen getrennt zu sein. Deshalb kommt es oft zum Anklammern an die Person oder zur Weigerung, die Bezugsperson zu verlassen – Kinder mit Trennungsangst wollen zum Beispiel oft nicht alleine schlafen. Die Trennungsängste können sich bei Kindern über Bauchschmerzen äußern oder darin, dass Kinder nicht in den Kindergarten oder in die Schule gehen wollen.
U
|
Hilfsangebote auf Englisch, Russisch und Ukrainisch (Psychological counseling in Ukrainian and Russian)
|
|
Das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit und sein Träger, die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) e. V. sprechen sich auf ihrer Website klar gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine aus. Zudem stellen sie dort ein Hilfsangebot auf Englisch, Russisch und Ukrainisch zur Verfügung:
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
W
siehe Aggression
Z
Viele Menschen kennen aus ihrem Alltag zwanghafte Gedanken oder ritualisierte Verhaltensweisen, die sich bald wieder verflüchtigen. Bei Menschen mit einer Zwangsstörung, drängen sich diese Gedanken und Verhaltensweisen immer wieder in sehr belastender Art und Weise auf. Die Betroffenen sind sich dessen bewusst, dass dieses Verhalten oder die Gedanken übertrieben oder unsinnig sind. Kindern ist dies nicht immer bewusst. Die betroffenen Personen versuchen meist Widerstand gegen die Zwänge zu leisten. Dies gelingt jedoch kaum oder überhaupt nicht, da der Gedanke, die Zwangshandlungen nicht auszuführen, sehr große Angst auslöst.
Sowohl bei Kindern als auch Erwachsenen ist häufig die ganze Familie in die Zwangshandlungen in Form bestimmter Rituale mit eingebunden wird. So dass die Zwangserkrankung den Alltag der Familie manchmal schon über Jahre hinweg bestimmt. Die Angehörigen wachsen in gewisser Weise langsam und anfänglich unbemerkt mit hinein. Da dies den Beteiligten in der Regel sehr peinlich ist, wird häufig erst sehr spät professionelle Hilfe geholt.
Es wird zwischen Zwangsgedanken und Zwangshandlungen unterschieden. Der Inhalt von Zwangsgedanken kann sich z.B. auf Verschmutzung, Aggressivität, Sexualität, Ordnung, Religiosität, die Furcht, andere zu verletzen, oder die Angst, dass etwas Schlimmes / Katastrophenartiges passiert, beziehen. Die von Zwangsgedanken Betroffenen sind dabei davon überzeugt, dass der Gedanke bedeutet, dass das Ereignis eintreten wird. Z.B. durch das Denken des Gegenteils wird versucht, den beängstigenden Zwangsgedanken zu neutralisieren.
Zwangshandlungen können z.B. Kontrollzwänge, Waschzwänge, Kontaktvermeidung, Wiederholungszwänge, Ordnungszwänge oder Zählzwänge einschließen, um bestimmte Dinge zu verhindern oder ein Gefühl der Sicherheit zu erlangen.
Zwangsstörungen sind die vierthäufigste psychische Erkrankung - 3,8% der Bevölkerung sind davon betroffen. Häufig treten Zwangsstörungen auch gleichzeitig mit anderen psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen oder Tic-Störungen auf. Es gibt mehrere Modelle, die die Entstehung von Zwängen erklären. Es gilt jedoch als gesichert, dass Vererbung eine entscheidende Rolle spielt.
Zwangsstörungen können mittlerweile gut therapiert werden. Bei der Therapie geht es im ersten Schritt um die Psychoedukation von betroffenen Kindern und ihren Familien, damit die Logik der Zwangserkrankung verstanden wird. Außerdem geht es darum, die Funktionalität der Zwänge zu erkennen. Darüber hinaus umfasst eine Verhaltenstherapie der Zwänge meist eine gestufte Exposition I Konfrontation, um die Zwänge überwinden zu können.